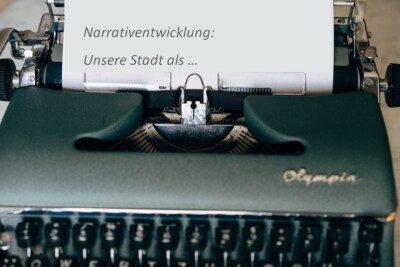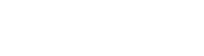Die Transformation von Straßen und Plätzen braucht neue Erzählungen, wie wir Mobilität denken und kommunizieren. Ein Appell von Willi Reismann: Lasst uns die Aufteilung des öffentlichen Raums und Geschwindigkeit, mit der wir uns in und durch diesen bewegen anders denken und öffentliche Räume wieder zu gemeinsamen Räumen machen!
Wieder gemeinsam durch Zeit und Raum – ein Apell!
Die fehlgeleitete Mobilität eines Jahrhunderts hat gesellschaftliche Trennungen verursacht, die wir zurückdrehen müssen. Das Auto hat dazu geführt, dass wir am Weg niemanden mehr treffen, und wenn dann nur mehr bei Unfällen oder im Stau, wenn wir die anderen durchs Autofenster beschimpfen. Wir rasen von einem Termin zum anderen an weit entfernen Orten, wir arbeiten im Stadtzentrum, Wohnen im Grünen, bringen die Kinder in der Früh gehetzt in den Kindergarten und in die Schule, am Nachmittag zum Sport oder zur Musik. Die Großeltern haben auch ein Auto. Die Kinder bekommen mit 16 ein Moped, mit 18 ein Auto.
Dieses „Sittenbild Mobilität“ ist seit einigen Jahrzehnten im Wandel zu Besseren, aber die Trennwirkung des Autos ist noch lange nicht behoben. Wir müssen die Bedeutung von Raum und Zeit für unser Leben wieder neu erkennen.
Heute haben wir die Chance, zwei Zeiten und zwei Welten zu verbinden, Raum und Zeit wieder gemeinsam zu nutzen.
Zwei grundsätzliche Parameter unseres Lebens müssen wir dabei neu einordnen und werten:
- die Geschwindigkeit ist kein erstrebenswertes Ziel, wir müssen sie reduzieren
- der Raum wird immer knapper, wir müssen ihn teilen und ihn sinnvoller nutzen
Wie kann das praktisch gehen, wenn unser aktuelles Verhalten doch klar im Widerspruch dazu steht?
Viele der folgenden Gedanken sind schon am Weg, aber es fehlt ihnen oft noch der Ort, sie praktisch umzusetzen, weil beispielsweise der Raum verplant und verbaut wurde.
Erkennen wir langsam begangene oder befahrene Wege wieder als soziale Chance.
Treffen wir am Weg Menschen, zufällig oder absichtlich, reden wir mit Fremden, lernen wir am Weg jemanden kennen. Das funktioniert zu Fuß, mit dem Fahrrad, im Geschäft, am Markt, im Zug, im Bus, in der Tram … aber das funktioniert nicht, wenn wir rasen, es eilig haben.
Schaffen wir Raum, Straßen und Plätze für langsame, gemeinsame Mobilität.
Schnell fahren sollen der Zug oder die Bim, ihnen überlassen wir eigenen, abgesicherten Raum. Den Raum, den wir durch Eindämmung des Individualverkehrs gewinnen, nutzen wir gemeinsam auf neue Weise. Wie diese Räume genutzt werden können, wird anhand von Praxisbeispielen wie beispielsweise der Postgasse in Villach oder dem Projekt „Ottensen mach Platz“ in Hamburg ersichtlich. Die Einnahme der Straße für den Menschen und die langsame Mobilität erhält bei den meisten Anrainer:innen einen hohen Zuspruch. Erfolgreiche Testphasen werden schlussendlich oftmals zu permanenten Umsetzungen, wie bei dem Beispiel in Hamburg.
Gewinnen wir Zeit für die Freizeit
indem wir wieder an denselben Orten wohnen, arbeiten, einkaufen, in die Schule und in den Kindergarten gehen, in der Nähe der Großeltern leben, im Freundeskreis Erledigungen aufteilen, die Freizeit in der Umgebung verbringen, weil sie wieder attraktiv geworden ist. Transformationen von öffentlichen Räumen bieten Potentiale für soziale Interaktionen und einen gemeinschaftlichen Austausch. Neben einer qualitativen Aufwertung der Umgebung ist auch an wichtige Nahversorger zu denken. Diese gebündelt an Orten aufzusuchen, erspart uns im Alltag Zeit da kurze Wege zurückgelegt werden.
Bringen wir diese Gedanken viel mehr als bisher in alle Bevölkerungskreise
Es besteht der Eindruck, dass diese Konzepte nur in Blasen gemacht und geschätzt werden, viele Gruppen der Bevölkerung nicht erreichen und von gar nicht so wenigen Gruppen abgelehnt werden. Sie hängen an der „alten Mobilität“ oder es wird ihnen politisch oder wirtschaftlich nahegebracht, dass neue Formen der Mobilität ihnen Nachteile bringen würden.
Die Demokratie tut sich oft schwer
nachhaltige Entwicklungen umzusetzen. Unsere falsch verstandene individuelle Freiheit steht dem entgegen. Kurzfristiger politischer Nutzen sticht langfristig notwendige Lösungen. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist hier entscheidend und kann nur erfolgreich sein, wenn sie politisch langfristig und gemeinsam getragen wird. Diese Verantwortung trifft die Politik und den Souverän, die Wählerinnen und Wähler. Es ist wichtig Veränderungen durch Fakten und Daten zu unterstreichen. Diese Informationen sind zeitnah zu Pressekonferenzen online und jedem verfügbar zu stellen. Durch klare Kommunikation werden falsche Befürchtungen eingedämmt und eine Akzeptanz in der Bevölkerung steigt.
Die Entwicklung der Wirtschaft
bestimmt in hohem Maße alle anderen gesellschaftlichen Entwicklungen. Welche Anreize müssen wir der Wirtschaft geben, damit sie sich nachhaltig entwickelt? Wie falsch sind unsere Anreize heute? Die Entwicklung der Einkaufszentren am Stadtrand, die Vereinsamung von Ortszentren, die Gefährdung belebter Einkaufsstraßen durch online-Shopping zeigen die Zusammenhänge. Manche Trends wie der online-Kauf werden nicht aufzuhalten sein. Wir werden unseren zu Shopping-Malls verkommenen Hauptstraßen in den Ballungsräumen einen neuen Sinn geben müssen.
Dem können Begegnungszonen erfolgreich entgegenwirken. Hierfür ist die Mariahilfer Straße in Wien ein Paradebeispiel [1]. Trotz anfänglich großer Abneigung zur Umgestaltung, wurde der Umbau von den Anrainer:innen und Besucher:innen als ein großer Erfolg angenommen. Vorhergesagte Umsatzeinbrüche sind nicht eingetroffen, vielmehr das Gegenteil. So hat die Begegnungszone einen positiven Effekt auf die Wirtschaft und wird von den Benutzer:innen als eine Art erweitertes Stadtzentrum angenommen [2]. Das Beispiel der Mariahilfer Straße zeigt außerdem wie die Umgestaltung eines Straßenabschnittes in die Umgebung abstrahlen und weitere Transformationen anstoßen kann. [3]
Leser:innen dieses Blog-Beitrages werden viele Gegenargumente finden. „Es ist eh schon alles gedacht, gesagt und geschrieben. Das ganze Projekt handelt davon. Es ist leicht, so übergeordnet zu schreiben. So einfach ist das in der Praxis nicht. In der Politik schon gar nicht. …“ Alles richtig, aber man muss den Menschen die großen Perspektiven aufzeigen, damit sie die praktischen Lösungen in ihrem Alltag mittragen. Die Wählerinnen und Wähler würden es schon verstehen und schätzen, wenn ihnen die Politik langfristige Perspektiven eindeutig und verständlich nahebringt. Es liegt in der Hand der Verwaltung auf die Bedürfnisse der Anwohner:innen zu gehen und eine klimafitte Zukunft zu planen.
Links:
- [1] Stadt Wien, MA 18 – Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Wissensmanagement (2015): MAHÜ. Magazin zu Umgestaltung und Neuorganisation der Wiener Mariahilfer Straße, Online verfügbar: Wienbibliothek: https://www.digital.wienbibliothek.at/download/pdf/4460069.pdf, abgerufen am 13.06.2024
- [2] Standard.at, Springer, Gudrun (2019): Begegnungszonen sind gut fürs Geschäft. 18.10.2019. Online verfügbar unter: https://www.derstandard.at/story/2000110059521/begegnungszonen-sind-gut-fuers-geschaeft, abgerufen am 13.06.2024
- [3] Petra Jens (2020): 5 Jahre Mariahilfer Straße: Als Wien das Flanieren lernte. 27.08.2020. Online verfügbar unter: https://www.wienzufuss.at/2020/08/27/5-jahre-mariahilfer-strasse/, abgerufen am 13.06.2024